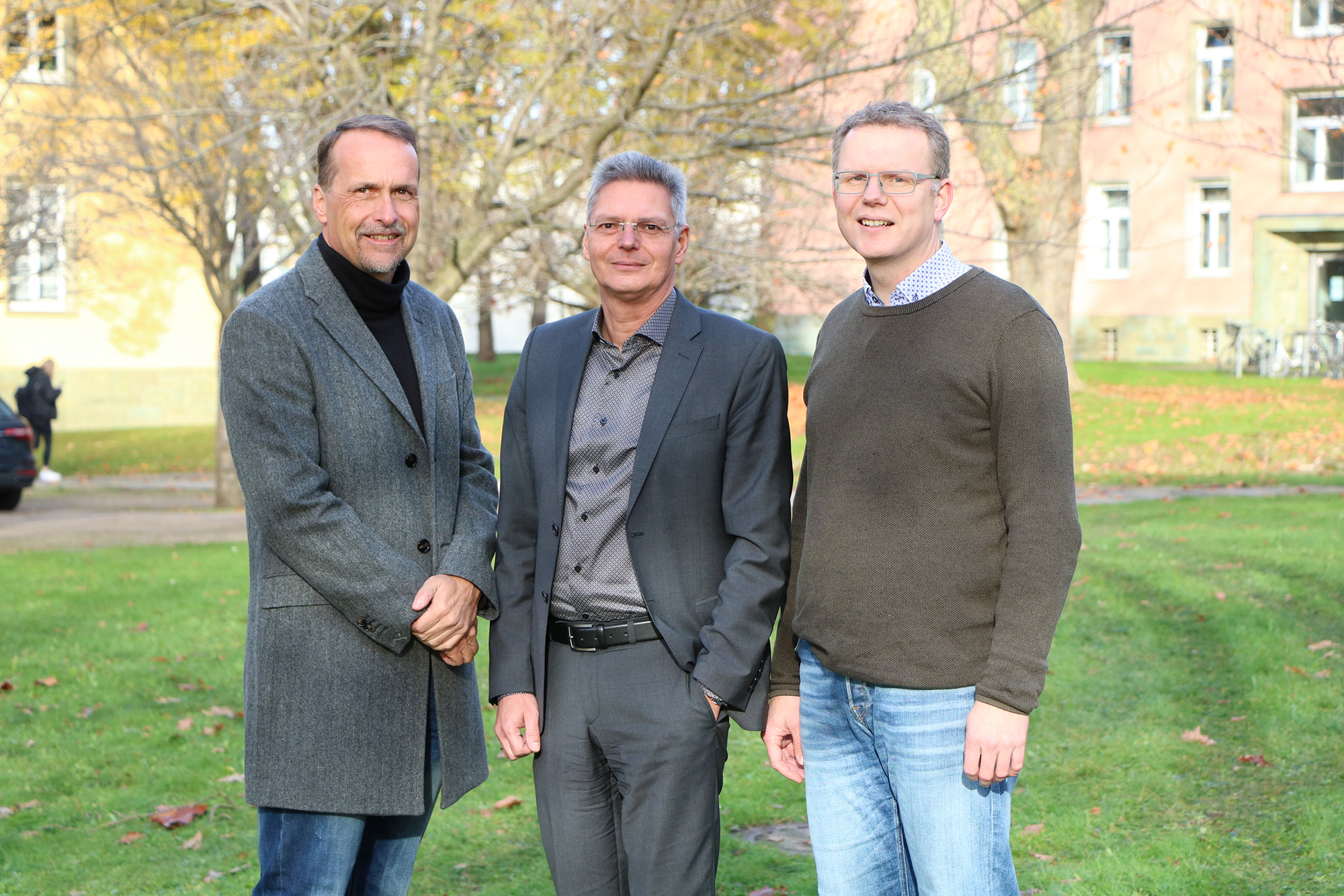Fachhochschule Südwestfalen erreicht Rang 10 der Fachhochschulen nach EU-Zuwendungen im Forschungsrahmenprogramm Horizont 2020
Die Fachhochschule Südwestfalen hat im Jahr 2023 eine starke Position im nationalen Vergleich der Beteiligung von Fachhochschulen in EU-Forschungsprojekten erreicht. Laut ECORDA-Vertragsdatenbank der EU steht die Hochschule per 8. Februar im Forschungsrahmenprogramm Horizont Europa nach EU-Zuwendungen auf Rang 19, im Programm Horizont 2020 sogar auf Rang 10. Warum sich ein Engagement in der EU-Forschung lohnt, erklären der Prorektor für Forschung und Transfer Prof. Dr. Andreas Nevoigt, der Geschäftsführer des Instituts i.green Dr. Ralf Biernatzki und EU-Referent Wolfgang Stauss im Interview.
Was ist das Besondere an EU-Forschungsprojekten?
Nevoigt: EU-Projekte sind anders. In den Aufrufen der üblichen nationalen Förderprogramme können unsere Wissenschaftler*innen alleine oder mit Projektpartner*innen Anträge stellen. In EU-Projekten sind hingegen – teils riesige – Netzwerke entscheidend. Man benötigt für ein Projekt mindestens drei Partner aus drei unterschiedlichen EU-Ländern. Netzwerkarbeit und europäisches Denken sind hier der Schlüssel zum Erfolg.
Biernatzki: Die Gutachterprozesse sind sehr aufwändig, das Gutachten-Scoring aber auch sehr transparent. Man erkennt sofort: Wo war ich gut, wo nicht so stark. Zudem benötigt man starke Partner, die in den jeweiligen Forschungsfeldern Spitzenpositionen besetzen.
Stauss: Es geht insofern mehr darum, hochkarätige Anträge abzugeben, als ein Netzwerk zu Fördertöpfen zu entwickeln. Deshalb ist es wichtig, sich zunächst in einem Netzwerk zu engagieren, um als Forschungspartner wahrgenommen zu werden. Dies kann dann zum Selbstläufer werden, wenn man sich als verlässlich liefernder Partner erweist.
Welche Projekte der Fachhochschule Südwestfalen haben denn in diesen Forschungsrahmenprogrammen bereits Zuwendungen erhalten?
Stauss: Aktuell ist hier der Fachbereich Agrarwirtschaft stark mit Prof. Dr. Wolf Lorleberg und Prof. Dr. Marcus Mergenthaler vertreten. Die Projekte proGIreg, FoodE, EFUA, INCiTiS-FOOD und BELIS drehen sich um Agrikultur, grüne Infrastrukturen, Ernährung und Nachhaltigkeit und verzeichnen ein Gesamtbudget für die Fachhochschule Südwestfalen von rund zwei Millionen Euro. Hinzu kommt das Digitalisierungsprojekt EDIH Südwestfalen von Prof. Dr. Gerrit Pohlmann, Prof. Dr. Christina Krins und Prof. Dr. Elmar Holschbach mit einem Budget von 870.000 Euro.
Wie wird man Partner in solchen europäischen Netzwerken?
Biernatzki: Man muss einen geschickten, meist individuellen Weg finden. Zunächst geht es darum, Sichtbarkeit hierzustellen. Interessierte Wissenschaftler*innen können beispielsweise in thematischen Netzwerken, sogenannten COST-Actions, zunächst ohne besondere Förderung teilnehmen und dort wissenschaftliche Kontakte knüpfen. Professor Lorleberg hat beispielsweise in der COST-Action „Urban Agriculture“ im Rahmen von Workshops und Publikationen mitgewirkt, danach kamen dann Anfragen zur Teilnahme in Forschungsprojekten.
Stauss: Dabei unterstützen wir auch administrativ gerne. Zu diesem Zweck gibt es an unserer Hochschule das Zentrum für Forschungsmanagement und Transfer. Interessierten Wissenschaftlern suchen wir Arbeitsprogramme mit konkreten Forschungsfragen heraus, recherchieren Themen für einen tieferen Einstieg und helfen bei Netzwerksuche und Kontaktaufbau.
Das klingt insgesamt nach einem erheblichen Aufwand.
Stauss: Einerseits ja. Zum Aufwand für die Sichtbarkeit in den Netzwerken wie beispielsweise Reisen oder eigene Beiträge kommt noch ein auf den ersten Blick erheblicher bürokratischer Aufwand. Für die Erstellung von Anträgen haben wir bereits Erfahrungswerte, die zwischen fünf und bis zu 200 Stunden liegen. Andererseits ist die administrative Hürde durch die Zahl an inzwischen bearbeiteten EU-Projekte jedoch deutlich niedriger als noch vor wenigen Jahren. Auch die erforderlichen Verwaltungsprozesse in Zusammenarbeit mit den Kollegen im Drittmittelbereich rund um die Beantragung und das Berichtswesen sind sehr gut eingespielt.
Sie würden also ein Engagement in diesen Forschungsprogrammen trotzdem empfehlen?
Nevoigt: Ja, in jedem Fall. Zum einen, weil in Deutschland aktuell die Forschungsförderung auf dem Prüfstand steht und wir schon deshalb Wissenschaftler*innen den Weg zu anderen Möglichkeiten außerhalb der nationalen Förderungen weisen möchten. Zum anderen, weil wir schon gezeigt haben, dass wir als Fachhochschule in der Lage sind, in solchen Konsortien zu bestehen. Früher wurden wir für unsere Initiative eher belächelt. In den letzten Jahren sind die europäischen Verbund-Forschungsprojekte jedoch anwendungsbezogener geworden und öffnen sich für Fachhochschulen.
Biernatzki: Eine Hemmschwelle ist insofern nicht angebracht und die Programme sind auch per se attraktiv. Die Antragsverfahren sind zwar langwierig, dafür laufen die Projekte aber auch drei bis fünf Jahre. So sind sie eher weniger für Sprintinnovationen geeignet, bieten aber ausreichende Mittel für intensive Forschung, also etwas für die Langstrecke.
Stauss: Als Voraussetzung muss die intrinsische Motivation groß genug sein. EU-Forschung ist aber in jedem Fall etwas für Wissenschaftler*innen, die Lust auf internationale Zusammenarbeit haben und Europa auf einer anderen Ebene erleben möchten. Die Zusammenarbeit mit Partnern in der europäischen Forschung ist lebendig, sehr bereichernd und schon ein Wert an sich.